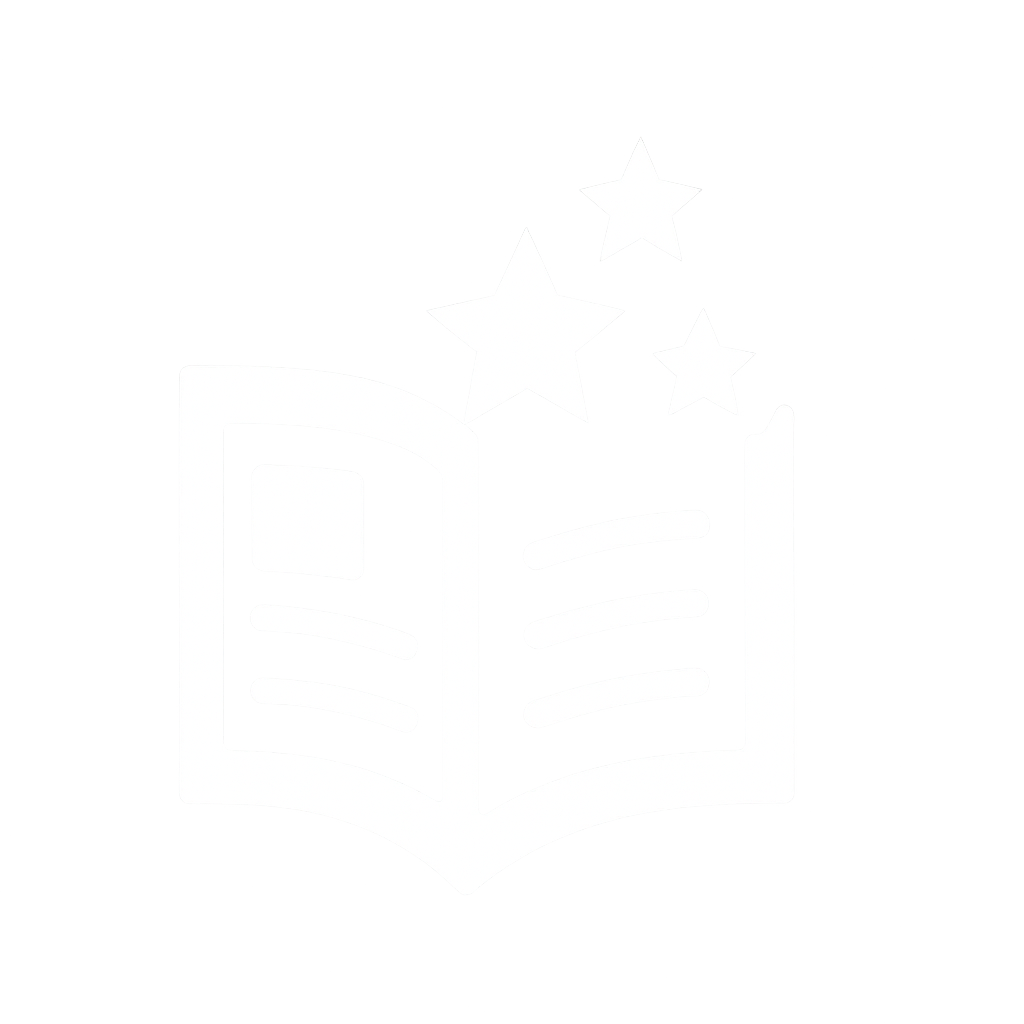Straßenverlauf
@strassenverlauf.bsky.social
3.1K followers
290 following
2.4K posts
Lea L. Fink
Doktorandin der Philosophie und historische Stadtführerin
✒️ Wien
✒️ Berlin
✒️ Brandenburg
Posts
Media
Videos
Starter Packs
Pinned
bellarocca3
@bellarocca3.bsky.social
· Aug 5

„Berlin lebt auf!“ Die Fotojournalistin Eva Kemlein (1909-2004)
kuratiert von Anna Fischer und Chana Schütz »Berlin lebt auf!« Die Fotojournalistin Eva Kemlein (1909-2004) Die Ausstellung widmet sich dem Lebenswerk der im Alter von 95 Jahren in Berlin verstorbenen...
centrumjudaicum.de
Reposted by Straßenverlauf