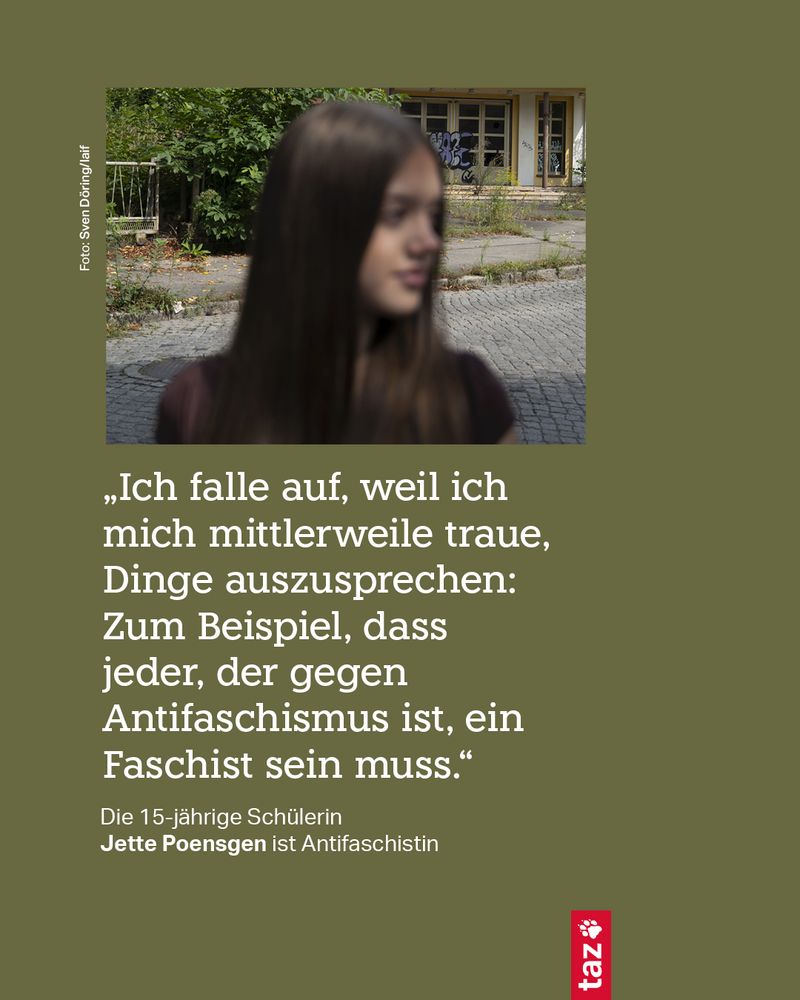Sarah-Maria Schober
@smschober.bsky.social
930 followers
910 following
48 posts
early modern historian, following civet cats and other species - humans included - through time and space, animal resources, racialization of hair, multispecies history / assistant professor , University of Lucerne
Posts
Media
Videos
Starter Packs
Pinned
Reposted by Sarah-Maria Schober
Reposted by Sarah-Maria Schober
Reposted by Sarah-Maria Schober
Reposted by Sarah-Maria Schober
Aparna Nair
@disabilitystor1.bsky.social
· Aug 27
Alex Merz 🇺🇸🇨🇦🇺🇦
@merz.bsky.social
· Aug 27
Reposted by Sarah-Maria Schober
infoclio.ch
@infoclio.bsky.social
· Aug 20
CfP: traverse 2/2027: Gemeines Land?
CfP: traverse 2/2027: Gemeines Land?
ed. Salome Egloff, Jamieson Myles, Sarah Schober
Wer nutzt das Land? Wie gestalten wir das Land? Wem gehört das Land? Nachdem Garrett Hardin die Allmende mit seinem Verdikt «the tragedy of the commons» für gescheitert erklärt hatte, erlebt sie seit den späten 2000ern eine Renaissance in wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten. Elinor Ostroms Arbeit und die in ihrer Tradition arbeitende neo-institutionelle Forschungsrichtung haben zum positiven Image der Commons beigetragen. Gesellschaftlich erhalten neue Projekte kollektiven Bewirtschaftens, oft in Kleinformaten wie dem gemeinsamen Gärtnern, in Zeiten von ökologischen Katastrophen und gesellschaftlicher Vereinzelung starken Zulauf. Vielleicht liegt ihre Anziehungskraft auch gerade darin begründet, dass diesen Formen oftmals etwas dezidiert «Vormodernes» anzuhaften scheint. Aber wieso ist das überhaupt so? Woher rührt das Potenzial des «Gemeinen» – und wie kann es aus historischer Perspektive greifbar werden?
Das Themenheft fragt mit seinem Fokus auf die Frage nach dem Gemeinen Land nach alltäglichen Praktiken des Bearbeitens, Nutzens, Teilens, Verwaltens und Unterhaltens von Land, sowie nach Strategien des Interessenausgleichs und der Konfliktschlichtung zwischen den – jeweils näher zu bestimmenden – Mitgliedern. Wir betrachten Commons als prozesshafte Projekte und im Anschluss an Niels Grüne, Jonas Hübner und Gerhard Siegl (2015) als soziale oder relationale Güter. Damit rückt das Heft weniger die grossen Veränderungen, wie die Auflösung «der» Allmende, noch institutionelle oder rechtliche Strukturen ins Zentrum, sondern Handlungsspielräume und Beziehungen. In einer Umkehr der Blickrichtung fragen wir also danach, wie die kollektiven Praktiken und Prozesse der Landnutzung die Gemeinschaften, ihre Institutionen und die Beziehungen zwischen den Mitgliedern und dem Land prägten. Mit dieser praxeologischen Ausrichtung nimmt das Heft auch Anregungen des in der jüngeren Forschung verbreiteten Ansatzes des «Commoning» auf.
Entsprechend können in den Beiträgen verschiedene Fragestellungen aufgegriffen werden: Wer gehörte überhaupt zum Kollektiv der Nutzungsberechtigten der Commons? Wer wurde ausgeschlossen – und durch welche sozialen, ökonomischen oder politischen Mechanismen? Wie konstituierten die gemeinsamen Praktiken Vorstellungen in Bezug auf Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Geschlecht- und Verwandtschaftssysteme oder auch menschlicher Superiorität? Welche Beziehungen entstanden zwischen den Menschen und nicht-menschlichen Akteur*innen – Tieren, Pflanzen, Infrastrukturen, Ökosystemen – im «Gemeinen», das oftmals eben gar nicht so allgemein war, wie es suggerierte? Wie also konstituierte, verfestigte und wandelten sich Idee und Praxis des «Gemeinen» im Verlauf der Zeit? Mit diesen Beziehungsverhältnissen zwischen Mensch und Land, menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen ist ein erstes Themenfeld konturiert.
Ein zweites mögliches Themenfeld geht dem Verhältnis zwischen dem gemeinen Land und staatlichen Institutionen (Feudalherren, Staaten, Kolonialmächte) nach. Brisanz erhält dieses Beziehungsfeld aktuell beispielsweise in den massiven Privatisierungseingriffen öffentlicher Flächen (v.a. Naturparks) in den USA. In verschiedenen Kontexten werden Gemeingüter mit Freiheit, Autonomie und Selbstermächtigung lokaler Gesellschaften in Verbindung gebracht. Im Westjordanland beispielsweise entstanden seit den 1960er Jahren kollektive Arbeits- und Eigentumsformen als Art des politischen Kampfes, wie Faiq Mari (2024) kürzlich gezeigt hat. In den grossen mitteleuropäischen Bauernkriegen der Vormoderne war die Verteidigung lokaler Selbstverwaltungsrechte gegen den obrigkeitlichen Zugriff ein zentrales Anliegen der bäuerlichen Bevölkerung. Gleichzeitig waren lokale Korporationen durchdrungen von der ständischen Sozialordnung und personell eng mit den regierenden Eliten verzahnt. Das Heft fragt deshalb auch nach den komplexen Beziehungen zwischen lokalen Kollektiven und staatlichen Institutionen sowie danach, wie die Vorstellungen von Freiheit, Gleichheit und Autonomie in der Gegenwart nachhallen.
Ein letztes anvisiertes Themenfeld ist dem Verhältnis zwischen Eigentum und Nutzung sowie dessen transepochalem Wandel gewidmet. Das Themenheft geht deshalb der Frage nach, wie die Konzipierung von Eigentum die Praktiken der Allmende prägte. Welchen Einfluss hatten zum Beispiel das koloniale Projekt mit seinem brachialen Verständnis von Eigentum und Ressourcennutzung oder die scheinbare Durchsetzung des Neoliberalismus nach dem «Fall» des Kommunismus auf die Gestaltung des kollektiven Wirtschaftens? Und wie wird die Idee des «Gemeinen Landes» in historischen und heutigen Debatten genutzt, aktualisiert und politisch instrumentalisiert? Diese letzte Frage ist insbesondere auch dann spannend, wenn das gemeine Land kontaminierte Wastelands oder auch latente Commons (Anna Tsing 2015) einschliesst.
Willkommen sind Beiträge aus allen Epochen und geographischen Räumen, sowohl zu vormodernen Formen wie zu modernen und aktuellen Gemeinschaftsnutzungen, ihren Praktiken, ihren Motivationen und gegebenenfalls ihrer Auseinandersetzung mit ihren historischen Vorbildern. Dabei interessieren wir uns für Landnutzung im weiten Sinn, einschliesslich Waldnutzung, Fischereirechte, Jagd oder die Organisation von Infrastruktur z.B. Wasserversorgung, sowie die Nutzung und Gestaltung von urbanem öffentlichem Raum.
Der geplante Heftschwerpunkt von traverse wird als Ausgabe 2/2027 erscheinen. Die Texte umfassen maximal 30.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) und werden im Peer Review-Verfahren (double blind) begutachtet. Alle Informationen zu den Formalia sowie das Style Sheet finden Sie hier.
Abstracts für Beiträge (ca. 500 Wörter, kurzer CV) sind bis zum 1.11.2025 zu senden an: [email protected], [email protected], [email protected]. Die Autor*innen werden bis zum 20.11.2025 über die Entscheidung der Heftherausgeber*innen benachrichtigt. Deadline für die Eingabe der Artikel ist der 1. Juni 2026.
Organisiert von
Zeitschrift für Geschichte – Revue d'Histoire
CS
20. August 2025
Anhang
CfP_Gemeines Land_190825_DE.pdf
Image for Content
dlvr.it
Reposted by Sarah-Maria Schober
Reposted by Sarah-Maria Schober
Venus Bivar
@vbivar.bsky.social
· Aug 14

We did the math on AI’s energy footprint. Here’s the story you haven’t heard.
The emissions from individual AI text, image, and video queries seem small—until you add up what the industry isn’t tracking and consider where it’s heading next.
www.technologyreview.com